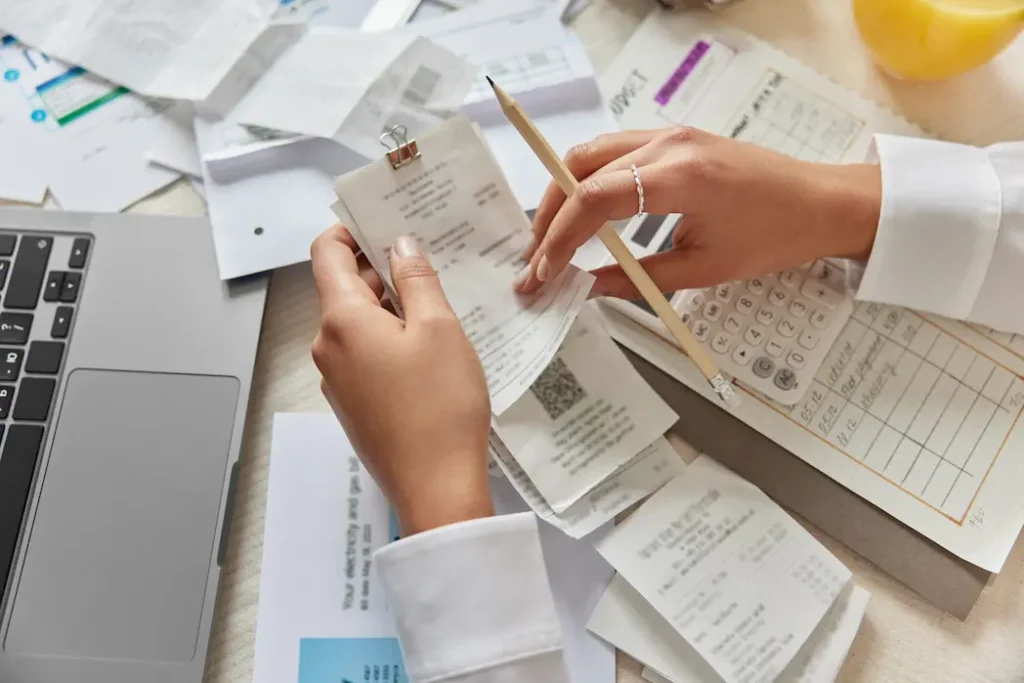Klartext im Kühlregal
Als Übersetzerin oder Übersetzer jongliert man täglich mit Bedeutungen, Konnotationen und sprachlichen Konventionen. Ein Wort ist nie „neutral“, denn hinter jeder Bezeichnung lauert eine Geschichte, eine Erwartung, eine kulturelle Färbung. Wenn das Europäische Parlament nun versucht, Bezeichnungen wie „vegane Bratwurst“, „Veggie-Schnitzel“ oder „veganer Burger“ zu verbieten oder zu beschränken, berührt das nicht nur die Lebensmittelindustrie, sondern das Sprachgefüge selbst.
Konkret geht es dabei gemäß dem Anhang zum Änderungsvorschlag an der EU-Verordnung Nr. 1308/2013 um folgende Begriffe, die sich ausschließlich auf Fleisch beziehen dürfen sollen:
Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Hähnchenfleisch, Putenfleisch, Entenfleisch, Gänsefleisch, Lammfleisch, Hammelfleisch, Schaffleisch, Ziegenfleisch, Unterschenkel, Filet, Hüfte, Lappen, Lende, Rippen, Schulter, Hesse, Kotelett, Flügel, Brust, Oberschenkel, Rinderbrust, Hochrippe, T-Bone-Steak, Roastbeef und Speck.
Gemäß dem Ergänzungsentwurf der konservativen französischen Abgeordneten Céline Imart sollen außerdem folgende Begriffe „geschützt“ werden:
Steak, Schnitzel, Wurst, Burger, Hamburger, Eigelb und Eiweiß.
Sprachliche Funktionen von „Veggie-Bezeichnungen“
Aber warum sagt man überhaupt „vegane Wurst“ oder „Veggie-Burger“ und nicht einfach „pflanzliche Schredderware“ statt „veganem Hack“? Aus linguistischer Sicht erfüllen solche Bezeichnungen mehr als nur einen Zweck.
1. Referenzielle Funktion - Die Bilder im Kopf
Wer beim Einkauf „Veggie-Burger“ liest, stellt sofort eine Verknüpfung zum Konzept „Burger“ her. Der Ausdruck suggeriert eine bestimmte Form, Textur und Verwendung (z. B. grillen, Brötchen, Patty). Wer „veganes Schnitzel“ liest, sieht einen panierten Bratling vor dem inneren Auge, auch wenn pflanzliche Zutaten drinstecken. Ohne die Anknüpfung an das bekannte Fleischprodukt müsste jede Alternative neu kommuniziert werden („pflanzlicher Patty mit Getreidebasis“) – das wäre oft weniger eingängig.
2. Kennzeichnung und Differenzierung
Adjektive wie „vegan“, „vegetarisch“ oder „pflanzlich“ signalisieren zur Differenzierung, dass es sich nicht um Fleisch handelt. Die Kombination („vegane Wurst“) ist eine typische Zweiteilung: der grobe Oberbegriff plus der differenzierende Zusatz. Diese Differenzierung geht viel mehr verloren, wenn etwa bei veganem Käse stattdessen von „Delikatess-Scheiben“ gesprochen wird und die angebrachten Bilder von Käse auf Milchbasis nicht zu unterscheiden sind.
3. Marketing / Markenkommunikation
Solche Begriffe helfen Produkten, sich in den Köpfen der Zielgruppen zu verankern. Wer einen vegetarischen oder veganen Lebensstil pflegt, denkt sofort an „Veggie-Burger“, und zwar ohne lange Umschreibungen. Sprachökonomie, Wiedererkennung, Markenwert, all das hängt am Label. So hatte denn auch in Frankreich Beyond Meat geklagt jeden das nationale Verbot dort. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten trägt selbst ebenfalls „Fleisch“ im Firmennamen.
Rechtliche Schranken: EuGH, Verbraucherschutz und Namensrecht
Als Übersetzer versteht man, dass Recht und Sprache sich wechselseitig bedingen.
Die EU-Verordnung über Lebensmittelinformation (Regulation (EU) Nr. 1169/2011) verlangt, dass Informationen über Lebensmittel nicht irreführend sein dürfen. Es geht vielmehr darum, dass Verbraucher die Möglichkeit haben, eine fundierte Wahl treffen zu können.
Das heißt: Wenn eine Bezeichnung suggeriert, dass ein Produkt Fleisch enthält (wo es das nicht tut), könnte das gegen das Irreführungsverbot verstoßen. Ob sich jemand durch ein „veganes Schnitzel“ getäuscht fühlt und erst Zuhause enttäuscht feststellt, dass dieses weder aus Veganern hergestellt wurde noch sonstiges Fleisch enthält, ist fraglich.
Dabei hatte der EuGH 2024 klargestellt, dass ein generelles nationales Verbot fleischähnlicher Begriffe für pflanzliche Produkte nicht zulässig ist, sofern eine klare Kennzeichnung erfolgt. Dies war in Frankreich bereits versucht worden. Allerdings hat auf europäischer Ebene eine ähnliche Regulierung für Milch und Milchprodukte bereits Erfolg gehabt, weswegen Begriffe wie „Milch“, „Käse“, „Joghurt“ mittlerweile laut EU-Recht für tierische Milchprodukte reserviert sind. Deshalb müssen pflanzliche Alternativen nun als „Drink“ oder „Aufstrich“ gekennzeichnet werden.
Allerdings bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel: Scheuermilch zum Beispiel wird aufgrund des Aussehens so genannt, hier scheint wohl keine Gefahr zu bestehen, diese versehentlich als „Scheuerdrink“ in den Kaffee zu gießen. Und auch Kokosmilch, welche aus geriebenem Fruchtfleisch besteht, darf weiterhin so genannt werden. Dabei besteht auch dieses Fruchtfleisch nicht aus Fleisch und die Kokosnuss ist eine Steinfrucht, keine Nuss. Auch der Wurstsalat darf weiterhin kein einziges Salatblatt enthalten. Eine Verwechslung scheint dem Gesetzgeber hier wohl ausgeschlossen.
Verbraucherbildung statt Sprachpolizei
Aus linguistischer Sicht ist das Vorhaben, bestimmte Begriffe zu sperren, ein Eingriff in den Wortschatz. Sprache lebt von Metaphern, Übertragung und Wandel. Wenn Regulierung in solche Prozesse eingreift, entstehen Spannungen und Konflikte. Es stellt sich die Frage, wer definieren darf, was als „falsch“ oder „unangemessen“ gilt. Wer entscheidet, welche Metaphern erlaubt sind? Definiert sich eine Wurst über den Fleischgehalt, die Form oder das Abfüllen in einer Schutzschicht?
Unterschätzen sollte man auch nicht die Sprachresilienz. Sprache weicht meist aus. Wenn ein Begriff offiziell verboten ist, entwickeln sich neue Ausdrücke, vielleicht dichter an der ursprünglichen Form. Vielleicht sprechen entsprechende Hersteller zukünftig von Vurstsalat. Dabei sollte das eigentliche Ziel sein, Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechend zu bilden, sodass diese nicht versehentlich zum veganen Hack greifen, wenn Sie Rinderhack wollten. Oder versehentlich Hackschnitzel in die Bolognese geben.

GDolmG: Übergangsfrist bis 2027 verlängert

Push the Future
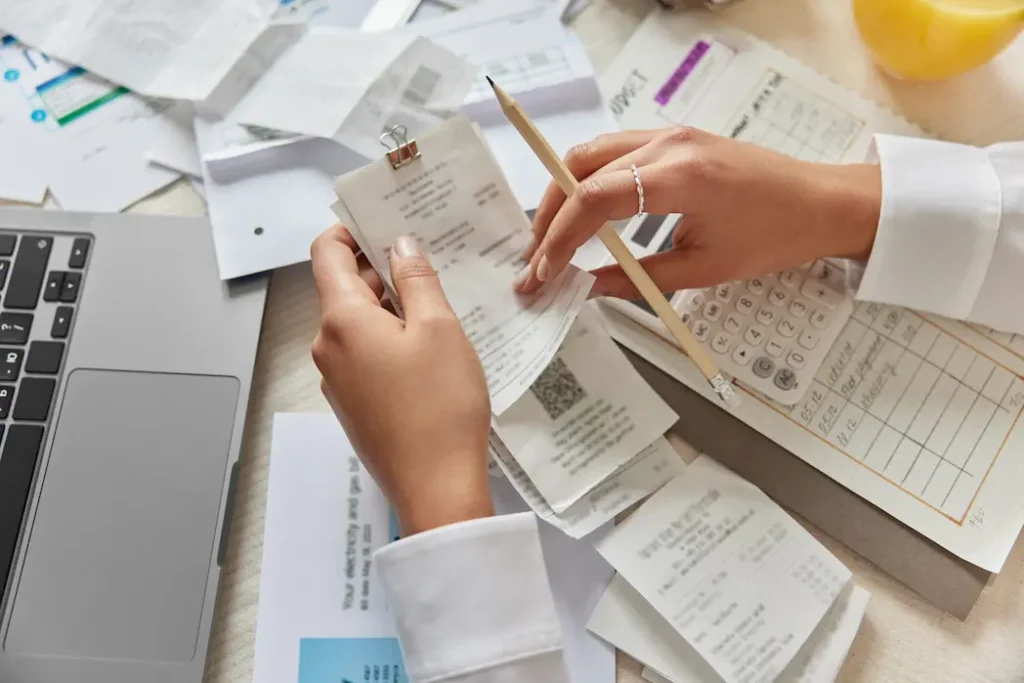
Kleinunternehmer & Rechnungen

Vegane Sprache – Es geht um die Vurst

Barrierefreie Texte – Leichte Sprache aus Übersetzersicht

Zwischen Deadline und Diplomatie
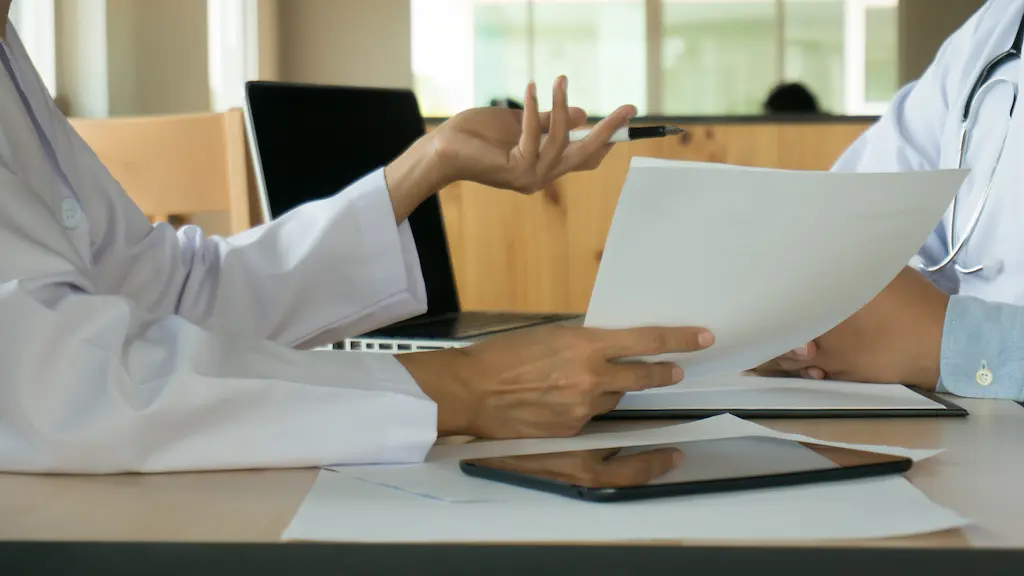

Warum Lokalisierung mehr ist als Übersetzung

60. Theodor Heuss Preis
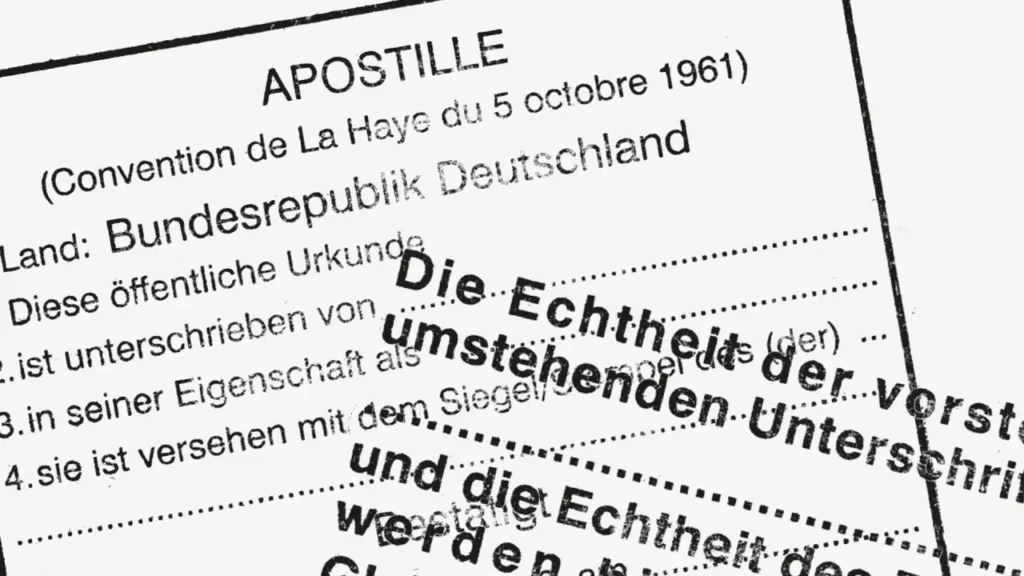

Die unsichtbare Gefahr: digitaler Übersetzungsbetrug

Geplante Anpassung des JVEG

Freiberufler-Visa in den VAE

Auswandern nach Dubai

Kürzungen und Restriktionen – Dolmetscher und Übersetzer in der Krise

Brücken bauen beim Wilhelm-Bock-Preis

Förderprogramme für Sprachmittler im Gesundheitswesen

Inklusion in der Bildung: ReSartus ermöglicht internationalen Austausch

Die Zukunft des Remote-Dolmetschens – virtuelle Konferenzen



Die Rolle der KI in der Übersetzungsindustrie

Hiiios – Der Videodolmetschdienst von ReSartus

Auswandern aus Deutschland

ReSartus unterstützt das 43. Erlanger Poetenfest

Vorbereitung für die Weltklimakonferenz COP28

GDolmG: Übergangsfrist bis 2027 verlängert

Push the Future