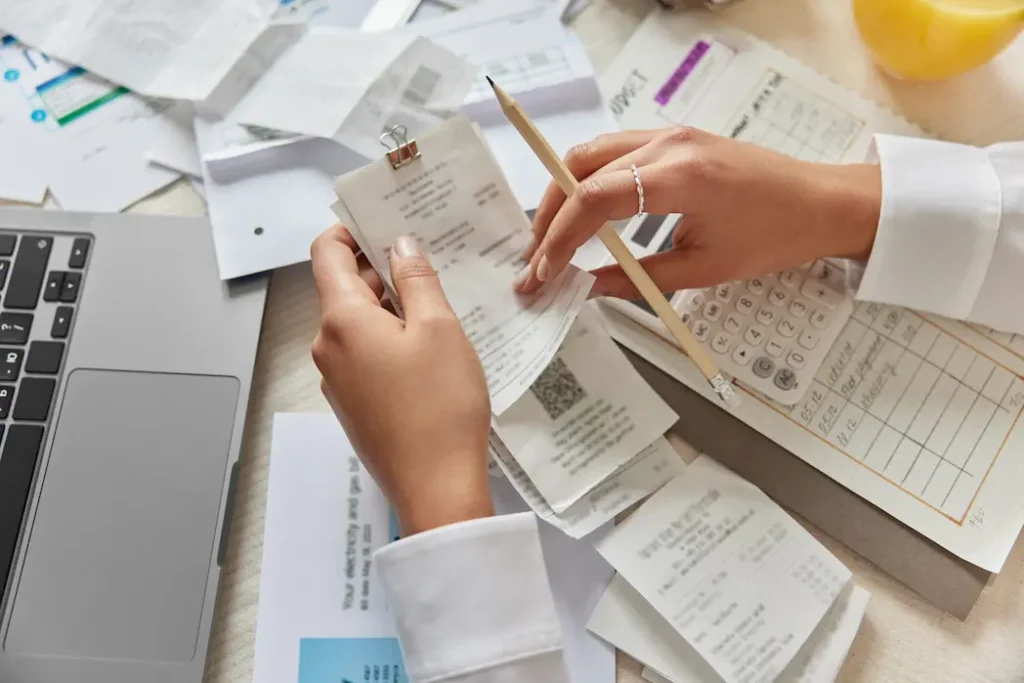Leichte und Einfache Sprache: Barrierefreie Kommunikation für alle
Verständliche Sprache ist ein Schlüsselelement moderner Kommunikation – sie sorgt dafür, dass Informationen für möglichst viele Menschen zugänglich sind. Unternehmen, Behörden und auch Übersetzungsbüros stellen sich daher zunehmend die Frage, wie Texte so formuliert werden können, dass niemand ausgeschlossen wird. Zwei Sprachformen stehen dabei besonders im Fokus: Leichte Sprache und Einfache Sprache. ReSartus im Gespräch mit Sarah Jane Borchert.
Was ist Leichte Sprache?
Leichte Sprache ist eine besonders streng geregelte Form der Vereinfachung. Sie orientiert sich an den niedrigsten Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (A1, A2). Sätze in Leichter Sprache sind sehr kurz (oft nicht mehr als 8–10 Wörter), pro Zeile und Satz wird nur eine Information vermittelt. Es werden ausschließlich vertraute, leicht verständliche Wörter verwendet, zum Beispiel ‚Haus‘ statt ‚Gebäude‘. Nebensätze und Konjunktiv werden vermieden, Bilder unterstützen die Verständlichkeit.
Die Texte werden zudem von Menschen aus der jeweiligen Zielgruppe geprüft, bevor sie veröffentlicht werden. Eine einheitliche, gesetzlich vorgeschriebene Regelung hierzu gibt es nicht, allerdings erschien im Frühjahr 2025 die DIN SPEC 33429:2025-03 (Empfehlungen für Deutsche Leichte Sprache) veröffentlicht. Dieses wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erarbeitet und kann kostenlos bei DIN Media heruntergeladen werden. Außerdem wurde ein Ratgeber vom BMAS in Kooperation mit dem Netzwerk Leichte Sprache herausgegeben, der dies an zahlreichen Beispielen erklärt.
Der Hauptzweck Leichter Sprache: Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit geistigen Beeinträchtigungen, Personen mit geringen Sprachkenntnissen oder ältere Menschen sollen Texte eigenständig lesen und verstehen können. Für sie kann Leichte Sprache beispielsweise bei Behördenformularen, Arztbesuchen oder auf Webseiten eine wertvolle Hilfe darstellen. Das Problem dabei ist aber, dass etwa bei behördlichen Formularen wie einem Kindergeldantrag eine Version in Leichter Sprache nicht rechtsverbindlich ist. Deshalb werden hier etwa Ausfüllhilfen erstellt, die beim Umgang mit Behördensprache helfen sollen.
Was ist Einfache Sprache?
Einfache Sprache ist näher am Standardhochdeutschen. Sie entspricht ungefähr dem Sprachniveau B1 und soll für alle verständlich sein – sie wird von rund 95 % der Bevölkerung verstanden. Im Fließtext sind längere Sätze und auch Nebensätze erlaubt. Fachbegriffe werden erklärt, aber dürfen grundsätzlich vorkommen. Seit 2023 gibt es auch die ISO-Norm 24495-1:2024-03, welche Kriterien wie Gestaltung, Zugänglichkeit, Prägnanz und Kohärenz sowie Miteinbeziehung der Zielgruppe definiert. Auch Einfache Sprache sollte mit der Zielgruppe abgestimmt werden.
Warum ist verständliche Sprache wichtig?
In Deutschland haben etwa 12% der Erwachsenen massive Leseschwierigkeiten, ist also funktioneller Analphabet – für jeden zweiten dieser 7,5 Millionen Menschen ist Deutsch die Muttersprache. Überall in Europa profitieren Menschen mit Demenz, Migrantinnen und Migranten, ältere Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder -behinderungen und viele weitere von barrierefrei aufbereiteten Texten.
Klar formulierte Sprache ermöglicht Teilhabe, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit – etwa in Behörden, bei medizinischen Informationen, in der Politik, aber auch bei Zugangs- und Sicherheitshinweisen. Die Akzeptanz wächst: Immer mehr Städte, Museen, Medienangebote wie die „Tagesschau in Einfacher Sprache“ oder „NachrichtenLeicht“ des Deutschlandfunk ermöglichen damit erleichterten Zugang zu Nachrichten und Tagesgeschehen.
Internationaler Vergleich
Auch in anderen Sprachen existiert das Konzept Leichte Sprache, die Umsetzung ist aber unterschiedlich weit fortgeschritten. Im Englischen gibt es das Konzept des „Easy Read“, wofür etwa das britische Gesundheitsministerium Handreichungen herausgibt. Im Französischen gibt es „facile à lire à comprendre“, kurz FALC, was „leicht zu lesen und zu verstehen“ bedeutet. Im Spanischen gibt es „Lectura fácil“ (Einfaches Lesen). Auch im Italienischen gibt es Ansätze für Leichte und Einfache Sprache. Im Italienischen findet man diese „lingua facile“ insbesondere in Südtirol, wo viele Menschen mit Deutsch als Muttersprache leben. In vielen Ländern fehlt jedoch noch eine flächendeckende, einheitliche Regelung.
Digitale Trends
Auch Übersetzungen mithilfe künstlicher Intelligenz stecken noch in den Kinderschuhen – maschinell vereinfachte Texte benötigen immer sorgfältiges menschliches Lektorat und Kontrolle durch die Zielgruppe. Dies ist schließlich eines der Kriterien, einen Text überhaupt als „Leichte Sprache“ bezeichnen zu dürfen. Vorreiter ist hier etwa Capito, die nicht nur eine TÜV-zertifizierte Methode zur Übersetzung in Leichte Sprache entwickelt haben, sondern auch eine darauf angepasste KI namens capito.ai entwickelt haben. Doch auch hier gilt, dass maschinell erstellte oder überarbeitete Texte immer von Menschen gegengeprüft und auch von der Zielgruppe überprüft werden müssen.
Herausforderungen in der Praxis
Texte in Leichter oder Einfacher Sprache zu verfassen, ist anspruchsvoll. So erklärt Sarah Jane Borchert, zertifizierte Übersetzerin für Leichte Sprache:
„Übersetzerinnen und Übersetzer müssen sich intensiv in die Lebenswelt der Zielgruppen eindenken, neue thematische Inhalte schnell erfassen, einen roten Faden entwickeln und sich eng mit Auftraggebern abstimmen. Eine wortgetreue Übertragung reicht nicht – vielmehr müssen Inhalte verständlich umgeschrieben werden, ohne wesentliche Details wegzulassen oder zu verfälschen. Die wichtigste Kontrolle bleibt die Rückmeldung durch die Zielgruppe selbst: Nur sie kann beurteilen, ob der Text wirklich verständlich ist. Schulungen, der Austausch in Netzwerken und regelmäßige Textprüfungen sind für professionelle Arbeit unerlässlich.“
Dies sei auch ein großes Problem aktueller digitaler Tools – da bei Leichter Sprache nicht 1:1 übersetzt wird, sondern um die Ecke gedacht werden muss, tut sich KI hier besonders schwer. Auch ersetzt sie in keinem Fall die enge Kooperation mit den Auftraggebern und der Zielgruppe. Wann ist das Weglassen von scheinbar unwichtigen Informationen Zensur, wann ist es im Interesse der Zielgruppe? Wie viel wird ausgelassen, wie viel zusätzlich erklärt?
Borchert selbst hat über ihr Engagement in Mehrzweckanlagen für Sport mit Menschen mit und ohne Behinderungen in Italien ihren Weg zur Leichten Sprache gefunden. Heute ist sie nicht nur beeidigte und staatlich geprüfte Dolmetscherin sowie ermächtigte Übersetzerin für Italienisch, sondern auch bei Special Olympics engagiert. Sie ergänzt:
„Dabei spielt auch die Einschätzung des Wissens- und Wortschatzniveaus der Zielgruppe eine zentrale Rolle. Wenn die Zielgruppe beispielsweise gut eingeschränkt oder definiert ist – etwa bei einem Brief an Athletinnen und Athleten – lässt sich der Sprachgebrauch besser anpassen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, lieber einmal zu oft zu erklären als einmal zu wenig, um Missverständnisse zu vermeiden.
Abkürzungen werden dabei oft nicht nur bei der ersten Verwendung erklärt, sondern auch im weiteren Textverlauf, etwa nach drei Seiten, erneut erläutert, um die Klarheit zu gewährleisten. Ergänzend können bei digitalen Dokumenten klickbare Links eingesetzt werden, die weiterführende Informationen bereitstellen, ohne den Haupttext zu überfrachten. Diese Kombination aus klarer Sprache, erklärenden Wiederholungen und multimedialer Unterstützung trägt wesentlich dazu bei, dass insbesondere digitale Texte für die Zielgruppe wirklich zugänglich und verständlich bleiben.“
Kritik an Leichter Sprache
Dabei gibt es auch immer wieder Kritik an Leichter Sprache. Nicht nur in Sozialen Medien, sondern auch in Zeitungskolumnen wird sie immer wieder als ‚Verdummung‘ der deutschen Sprache verunglimpft. Inhalte würden übermäßig vereinfacht, die Lesenden infantilisiert – und das im „Land der Dichter und Denker“. Ob Leichte Sprache nicht zu leicht sei, entgegnet Borchert:
„Diese Rückmeldung kommt nie von der Zielgruppe. Nur von denen, die nicht davon profitieren. Eigentlich profitieren alle Menschen von Leichter und Einfacher Sprache.“
Und insbesondere die vielen öffentlichen Angebote und die weiter steigende Bekanntheit fördern eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. Um hier ein Bewusstsein zu schaffen und Menschen in Leichter Sprache zu schulen, gibt Borchert selbst auch Schulungen zum Thema. Das Wichtigste hierbei sei jedoch immer auch der Umgang mit der Zielgruppe. Nur so kann ein Verständnis dafür entwickelt werden, was erklärungsbedürftig ist und was nicht.
Auch als Dolmetscherin für Italienisch vor einem Betreuungsgericht kamen Borchert ihre Erfahrungen im Umgang mit Leichter und Einfacher Sprache bereits zugute. In Absprache mit dem Richter konnte sie dadurch in Betreuungssachen vermitteln. Hierbei ist es zentral, den Beteiligten klarzumachen, dass es sich hierbei in keinem Fall um eine 1:1 – Verdolmetschung handeln kann. Es geht schließlich um die Vermittlung von Inhalten und das Verständnis auf allen Seiten.
Fazit
Leichte und Einfache Sprache sind längst kein Nischenthema mehr – sie sind zentral für die Vermittlung von Informationen in einer diversen Gesellschaft. Übersetzerinnen und Übersetzer übernehmen dabei eine wichtige Brückenfunktion: Sie helfen, Botschaften barrierefrei zu gestalten und so alle Menschen – unabhängig von ihren Sprachkenntnissen oder kognitiven Fähigkeiten – zu erreichen.
Zur Person:
Sarah Jane Borchert ist nicht nur ermächtigte Übersetzerin und allgemein beeidigte Dolmetscherin für Italienisch. Nach ihrem Masterabschluss im Fachübersetzen an der Universität Bari arbeitet sie seit 2016 freiberuflich für Gerichte und Konsulate. Seit mehreren Jahren liegt ihr Schwerpunkt zudem auf Leichter und Einfacher Sprache, u. a. als Verantwortliche für Leichte Sprache und Easy Read beim LOC der Special Olympics Weltspiele 2023 in Berlin.

GDolmG: Übergangsfrist bis 2027 verlängert

Push the Future
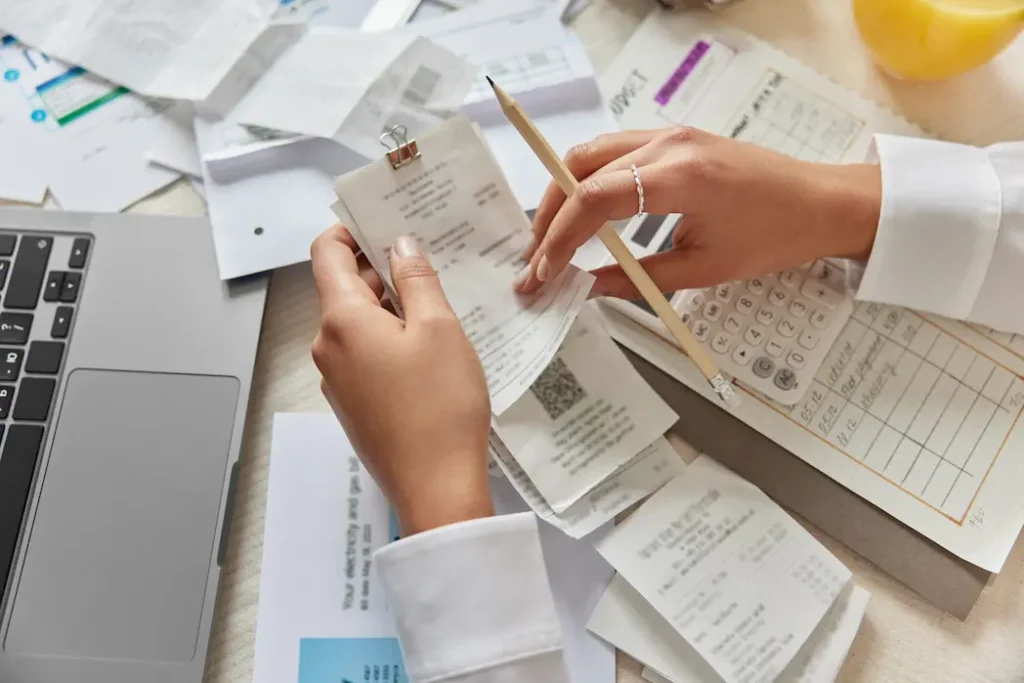
Kleinunternehmer & Rechnungen

Vegane Sprache – Es geht um die Vurst

Barrierefreie Texte – Leichte Sprache aus Übersetzersicht

Zwischen Deadline und Diplomatie
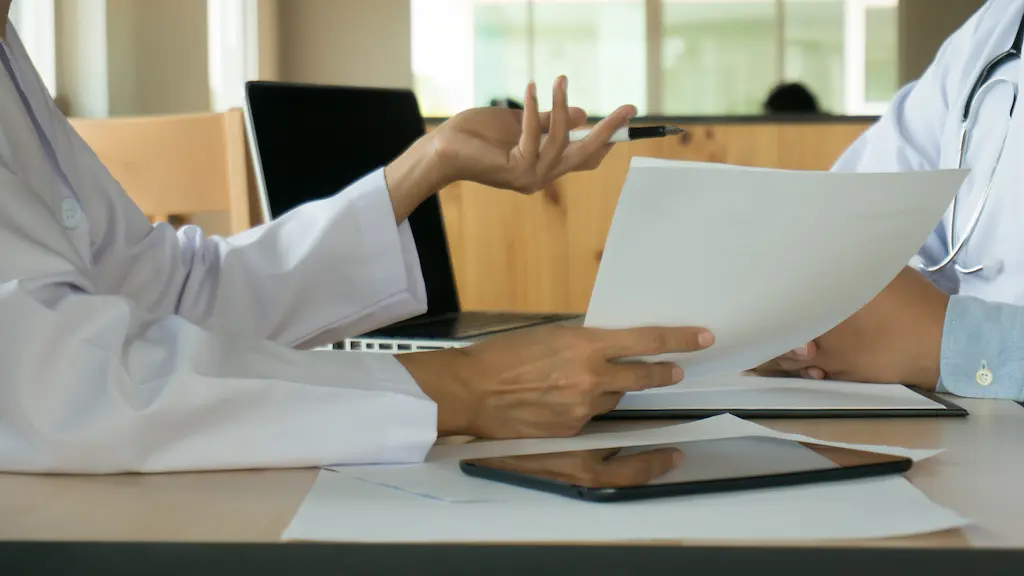

Warum Lokalisierung mehr ist als Übersetzung

60. Theodor Heuss Preis
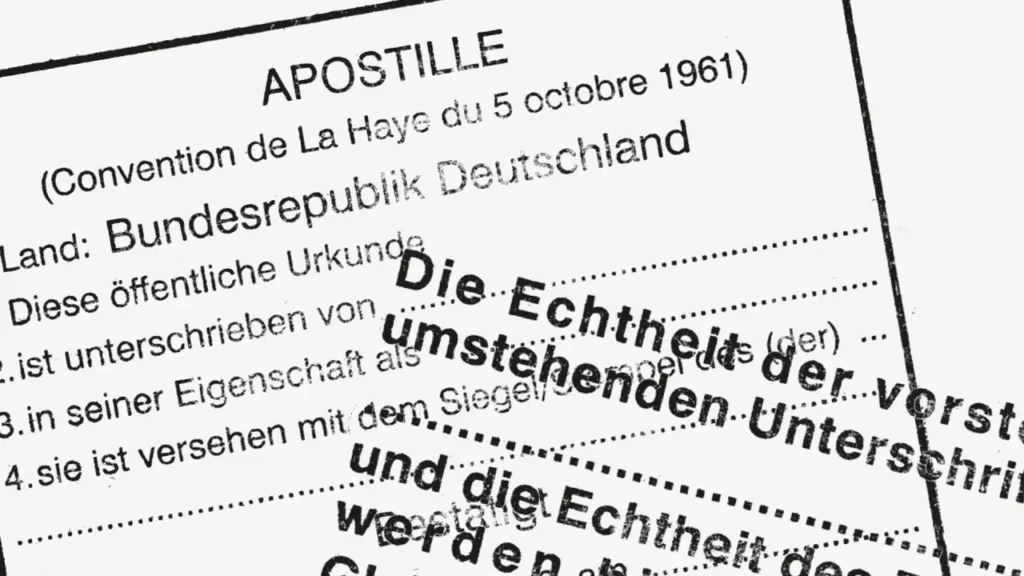

Die unsichtbare Gefahr: digitaler Übersetzungsbetrug

Geplante Anpassung des JVEG

Freiberufler-Visa in den VAE

Auswandern nach Dubai

Kürzungen und Restriktionen – Dolmetscher und Übersetzer in der Krise

Brücken bauen beim Wilhelm-Bock-Preis

Förderprogramme für Sprachmittler im Gesundheitswesen

Inklusion in der Bildung: ReSartus ermöglicht internationalen Austausch

Die Zukunft des Remote-Dolmetschens – virtuelle Konferenzen



Die Rolle der KI in der Übersetzungsindustrie

Hiiios – Der Videodolmetschdienst von ReSartus

Auswandern aus Deutschland

ReSartus unterstützt das 43. Erlanger Poetenfest

Vorbereitung für die Weltklimakonferenz COP28

GDolmG: Übergangsfrist bis 2027 verlängert

Push the Future