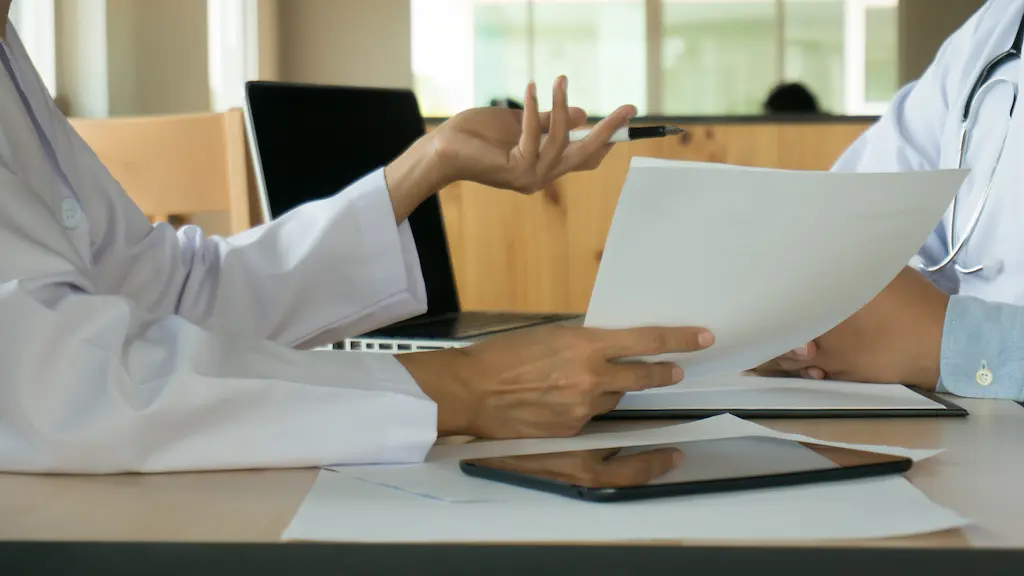Wie Übersetzer*innen Konflikte mit Kund*innen vermeiden und meistern
Sprachprofis sind Brückenbauer zwischen Kulturen. Sie übersetzen Verträge, Fachtexte oder Reden und sorgen dafür, dass Verständigung über Sprachgrenzen hinweg gelingt. Doch in der Praxis kämpfen Übersetzer*innen und Dolmetscher*innen nicht selten mit Herausforderungen, die über reine Sprachkenntnisse hinausgehen. Immer wieder kommt es zu Missverständnissen oder Konflikten, die sowohl die Qualität der Arbeit als auch die Beziehung zu Kund*innen belasten. Ein genauerer Blick auf typische Stolperfallen zeigt, wie diese entstehen – und wie sich viele von vornherein vermeiden lassen.
Wenn das Ausgangsmaterial schon Schwierigkeiten bereitet
Nicht jede Übersetzung beginnt mit einem sauberen Word-Dokument. Häufig landen bei Sprachprofis PowerPoint-Präsentationen, eingescannten PDFs oder sogar handschriftliche Notizen auf dem Tisch. Während gut strukturierte Dateien eine zügige Bearbeitung ermöglichen, verursachen unsaubere Vorlagen erheblichen Mehraufwand. Texte aus Bildern oder Scans müssen zum Teil mühsam transkribiert werden, was Zeit kostet, und die Fehlerquote erhöht.
Für Übersetzer*innen bedeutet das eine Gratwanderung: Einerseits möchten sie Kund*innen unterstützen, andererseits sind zusätzliche Arbeitsschritte nicht automatisch Teil des vereinbarten Auftrags. Deshalb weisen viele darauf hin, dass das Ausgangsmaterial entscheidend für den Zeit- und Kostenrahmen ist. Wer also mit ungewöhnlichen Dateiformaten arbeitet, sollte offen sein für Zusatzkosten oder längere Bearbeitungszeiten – ein Punkt, der im Vorfeld unbedingt geklärt werden sollte.
Translation Memories: Hilfreich, aber nicht harmlos
Ein weiteres Thema, das immer wieder Diskussionen auslöst, sind Translation Memories (TM). Dabei handelt es sich um digitale Datenbanken, die bereits übersetzte Textsegmente speichern und so helfen, Terminologie konsistent zu halten und Prozesse effizienter zu gestalten. Für Übersetzer*innen sind sie ein wertvolles Werkzeug – und zugleich ein Stück geistiges Eigentum.
Konflikte entstehen, wenn Auftraggeber*innen annehmen, die Datenbank gehöre ihnen automatisch, sobald sie für die Übersetzung bezahlt haben. Aus Sicht der Übersetzer*innen ist das problematisch: Ein TM gleicht einer persönlichen Bibliothek, die über Jahre aufgebaut wurde. Es enthält Wissen, das nicht mit einem einzelnen Auftrag, sondern mit der gesamten beruflichen Erfahrung zusammenhängt. Deshalb plädieren viele dafür, die Nutzung oder Herausgabe von TMs klar zu regeln und gegebenenfalls gesondert zu vergüten. Ohne solche Vereinbarungen drohen Missverständnisse, die eine Zusammenarbeit belasten können.
Feedback, das weiterbringt – und solches, das blockiert
Kein Übersetzer arbeitet im luftleeren Raum: Feedback ist wichtig, um Texte passgenau an die Zielgruppe anzupassen. Doch die Art, wie Kritik geäußert wird, entscheidet darüber, ob sie als hilfreich oder verletzend empfunden wird. Pauschale Aussagen wie „Das ist alles falsch“ sind frustrierend und wenig zielführend. Sie vermitteln weder, wo das Problem liegt, noch wie es gelöst werden kann.
Übersetzer*innen wünschen sich stattdessen konkrete Hinweise: Soll der Text formeller sein? Ist die Tonalität zu technisch? Oder wurden bestimmte Fachbegriffe übersehen? Solche Rückmeldungen fördern nicht nur die Qualität, sondern stärken auch das Vertrauen zwischen beiden Seiten. Ein respektvoller Dialog, der Fachkompetenz anerkennt, trägt wesentlich dazu bei, Konflikte zu vermeiden und eine dauerhafte Zusammenarbeit aufzubauen.
Geldfragen: Sicherheit für beide Seiten
Kaum ein Thema ist so konfliktträchtig wie die Bezahlung. Für freiberufliche Sprachprofis sind pünktliche Zahlungen überlebenswichtig, da sie weder feste Gehälter noch Rücklagen großer Unternehmen haben. Besonders schwierig wird es bei internationalen Projekten: Während in Deutschland kurze Zahlungsfristen üblich sind, sehen andere Länder 30 oder gar 45 Tage als Standard. Hinzu kommen Probleme mit Transaktionsgebühren, die teils ungeklärt bleiben.
Übersetzer*innen fordern daher klare Vereinbarungen schon vor Projektbeginn: Wann wird gezahlt, in welcher Währung und über welchen Weg? Bei neuen Kund*innen greifen viele auf Vorkasse oder Teilzahlungen zurück, um Risiken zu minimieren. Solche Regelungen sind nicht Ausdruck von Misstrauen, sondern schlicht notwendig, um Planungssicherheit zu gewährleisten und ihre Arbeit professionell durchführen zu können.
Warum Qualität ihren Preis hat
Ein häufiger Streitpunkt ist auch die Preisgestaltung. Viele Auftraggeber*innen orientieren sich an der Wortzahl und vergessen dabei, dass professionelle Übersetzungen weit mehr umfassen: Fachrecherche, stilistische Feinarbeit und die Verantwortung, dass Inhalte rechtlich oder technisch einwandfrei wiedergegeben werden.
Für Übersetzer*innen bedeutet Dumpingpreis-Druck nicht nur geringere Einnahmen, sondern auch den Verlust an Professionalität. Wer seine Arbeit zu billig anbietet, kann die nötige Sorgfalt oft nicht aufbringen – ein Nachteil, der letztlich auch Kund*innen trifft. Transparente Angebote, die alle Leistungen aufschlüsseln, helfen hier, Missverständnisse zu vermeiden. Sie machen sichtbar, dass Qualität ihren Preis hat – und dass sich eine faire Bezahlung langfristig auszahlt.
Dolmetschen: Arbeit im Ausnahmezustand
Während Übersetzer*innen in Ruhe am Schreibtisch arbeiten, stehen Dolmetscher*innen im Live-Modus. Sie müssen ohne Zeitverzug das Gesagte in eine andere Sprache übertragen – Fehler lassen sich nicht korrigieren. Der Druck ist enorm, und die Erwartungen sind hoch.
Ein häufiges Problem ist, dass Auftraggeber*innen den Aufwand unterschätzen. Jede Konferenz, jedes Meeting erfordert intensive Vorbereitung: Themenrecherche, Terminologiearbeit und mentale Vorbereitung. Werden Materialien nicht rechtzeitig bereitgestellt, leidet die Qualität zwangsläufig. Hinzu kommen Belastungen wie spontane Einsätze am Wochenende, ständige Erreichbarkeit oder lange Reisen, die oft nicht angemessen honoriert werden. Viele Dolmetscher*innen fordern daher klare Rahmenbedingungen: rechtzeitige Informationen, faire Arbeitszeiten und eine angemessene Vergütung für Zusatzbelastungen. Nur so kann die Qualität gewährleistet werden, die Kund*innen erwarten.
Selbstschutz durch „Nein“
Ein Punkt, den viele Sprachprofis erst mit Erfahrung lernen: Ein klares „Nein“ gehört zu den wichtigsten Werkzeugen im Berufsalltag. Nicht jede Anfrage ist seriös, realistisch oder ethisch vertretbar. Doch die Hemmschwelle, Aufträge abzulehnen, ist gerade bei Berufseinsteiger*innen hoch.
Die Realität zeigt: Manchmal ist ein Nein der einzige Weg, Qualität und Integrität zu sichern. Dazu zählen Eilaufträge, die in der geforderten Zeit nicht machbar sind, oder unendliche Korrekturschleifen, die weit über das Vereinbarte hinausgehen. Besonders heikel sind Anfragen, die in den Bereich der Manipulation fallen – etwa das nachträgliche Verändern von Namen in offiziellen Dokumenten oder das Uminterpretieren von Berufsbezeichnungen. Hier geht es nicht nur um Arbeitsbelastung, sondern auch um rechtliche und ethische Grenzen. Ein professionelles Nein ist deshalb kein Zeichen von Unwilligkeit, sondern von Verantwortung.
Fazit
Ob beim Übersetzen oder Dolmetschen: Konflikte entstehen oft weniger durch die Arbeit selbst, sondern durch fehlende Absprachen und unrealistische Erwartungen. Wer die Perspektive der Sprachprofis berücksichtigt, erkennt schnell: Gute Zusammenarbeit basiert auf klaren Regeln, fairer Bezahlung und gegenseitigem Respekt. Kund*innen, die diese Punkte ernst nehmen, profitieren nicht nur von reibungslosen Abläufen, sondern vor allem von hochwertigen Ergebnissen – und Sprachprofis können ihre Arbeit nachhaltig und mit voller Qualität leisten.

Zwischen Deadline und Diplomatie
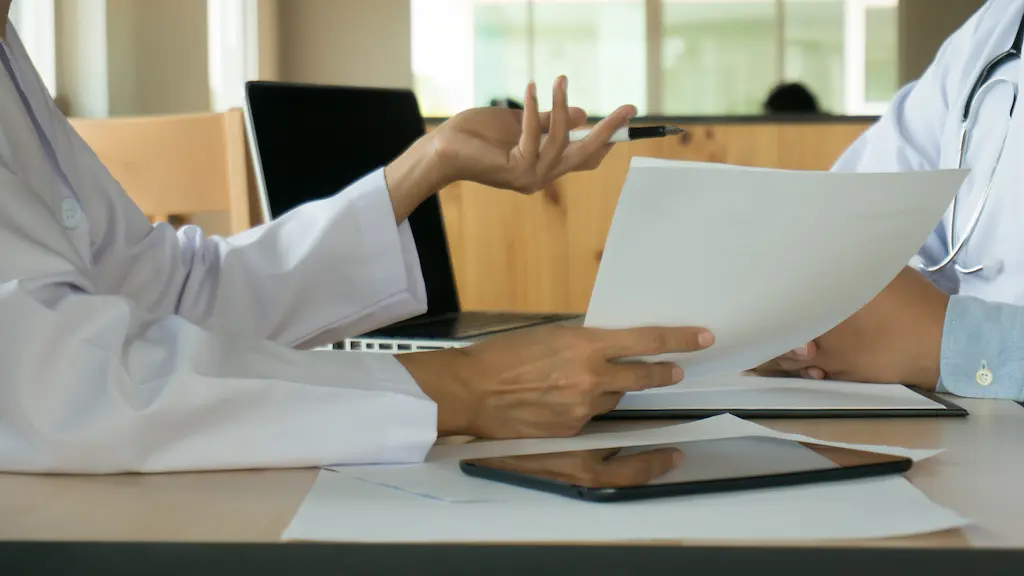

Warum Lokalisierung mehr ist als Übersetzung

60. Theodor Heuss Preis
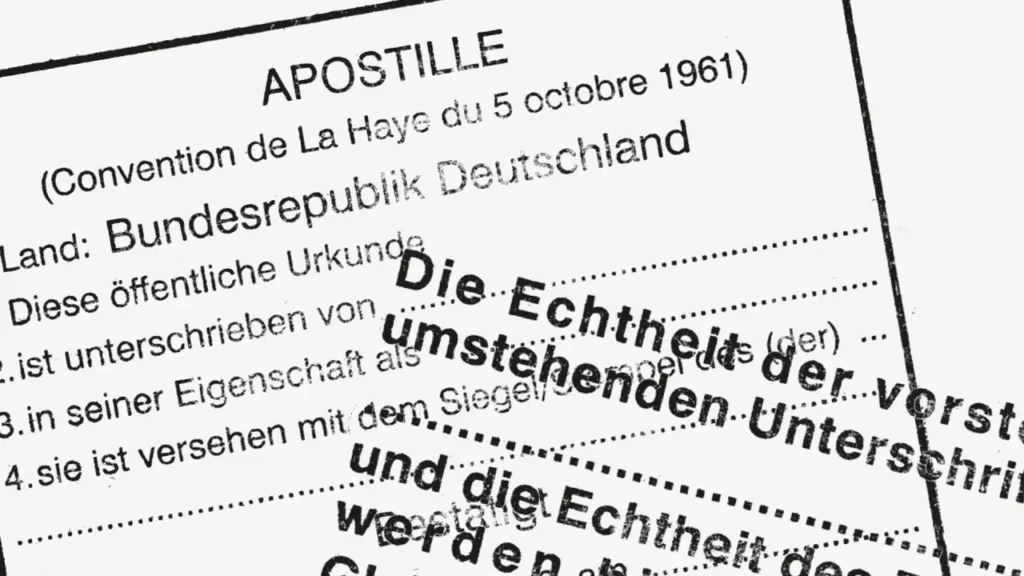

Die unsichtbare Gefahr: digitaler Übersetzungsbetrug

Geplante Anpassung des JVEG

Freiberufler-Visa in den VAE

Auswandern nach Dubai

Kürzungen und Restriktionen – Dolmetscher und Übersetzer in der Krise

Brücken bauen beim Wilhelm-Bock-Preis

Förderprogramme für Sprachmittler im Gesundheitswesen

Inklusion in der Bildung: ReSartus ermöglicht internationalen Austausch

Die Zukunft des Remote-Dolmetschens – virtuelle Konferenzen



Die Rolle der KI in der Übersetzungsindustrie

Hiiios – Der Videodolmetschdienst von ReSartus

Auswandern aus Deutschland

ReSartus unterstützt das 43. Erlanger Poetenfest

Vorbereitung für die Weltklimakonferenz COP28

Zwischen Deadline und Diplomatie